| Home Unser Verein
Oppershofen
Rockenberg
Bardo-Archiv
Marienschloß
Publikationen
Aktuelles
Links
Kontakt |
Chronologie von Oppershofen
Inhalt:
Daten zur älteren
Geschichte von Oppershofen
Autor: Dieter Lehmann
Chronologische
Abfolge der Ortsgeschichte von Oppershofen
vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart
Autoren: Manfred Breitmoser und Alexander F. Fiolka
Daten zur älteren
Geschichte von Oppershofen
zusammengestellt von Dieter Lehmann
Die Anfänge des Ortes Oppershofen liegen im
Dunkel. Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 11. Jh. Weitere Erwähnungen
aus jenem Zeitraum weisen darauf hin, daß der Ortsname bereits im 10. Jh. bestanden hat.
Die Anwesenheit von Menschen läßt sich bis
zurück in die Altsteinzeit nachweisen. Nach Erfindung und Ausbreitung von Ackerbau und
Viehzucht, verbunden mit der Seßhaftwerdung der Menschen, gehörte die fruchtbare
Wetterau zu den am intensivsten genutzten Räumen. Im Bereich von Oppershofen läßt sich
menschliche Anwesenheit und Tätigkeit, meist auch Siedlung, über alle nur archäologisch
faßbaren Epochen verfolgen, von der Jungsteinzeit bis ins Frühmittelalter.
Im 8. Jh., zur Zeit des Fränkischen Reiches,
setzt für den hiesigen Raum die schriftliche Überlieferung allmählich ein. Dadurch
werden uns auch Namen von Siedlungen, Institutionen und handelnden Personen bekannt.
Im Bereich der heutigen Großgemeinde
Rockenberg-Oppershofen spielte eine Siedlung eine bedeutenden Rolle, die in den
lateinischsprachigen Quellen meist Cruftila, eingedeutscht Crüftel genannt wird.
Die drei Orte Crüftel, Oppershofen und Rockenberg sind in dieser Reihenfolge entstanden,
bestanden für Jahrhunderte nebeneinander und waren stets eng miteinander verbunden.
Crüftel hatte allerdings nach dem Aufkommen der neueren Siedlungen Oppershofen und
Rockenberg stark an Bedeutung verloren. Seit dem 16. Jh. verlieren sich die Spuren seines
Namens.
_____
| 980/981 |
Nach den Angaben der nach 1055
[s.u.] verfaßten Lebensbeschreibungen des Hl. Bardo wurde der in einem dieser Jahre in
Oppershofen geboren. |
1047-
1056 |
Erste urkundliche Erwähnung von
Oppershofen.
Ein Adliger namens Hecil und seine Gattin Outa [Uta] tätigen eine
umfangreiche Schenkung für die Abtei Fulda. Unter den Schenkungsgütern befinden sich
alle ihre Besitzungen in Oppershofen, bestehend aus 2 Hufen. |
| 1051 |
Am 11. Juni jenes Jahres starb
Bardo als amtierender Erzbischof von Mainz. Während seiner Amtszeit als Erzbischof soll
Bardo die erste Kirche in Oppershofen gestiftet und mit 4 Hufen ausgestattet haben. |
1055-
1058 (?) |
In diesem Zeitraum sind
wahrscheinlich zwei erhaltene Lebensbeschreibungen des hl. Bardo entstanden. Danach
stammte Bardo aus Oppershofen (Habprahteshoven). Bardos Eltern hätten die Namen
Adalbero und Christina getragen, seine beiden Brüder hießen Harderath und Helizo. Da
Bardos Verwandtschaft mit der Kaiserin Gisela angesprochen wird, konnte erschlossen
werden, daß seine Familie zum weiteren Verwandtschaftskreis der Konradiner gehörte. |
| 1128 |
Adalbert I. von Saarbrücken,
Erzbischof von Mainz, übergab dem Domkapitel von Mainz u.a. die Rechte für diverse
Einkünfte des Erzstifts, darunter auch die Rechte für 10 Schilling in Oppershofen (Herbretdeshoven).
|
| 1191 |
Erzbischof Konrad I. von Mainz
nahm das Stift Retters [heute 'Rettershof' bei Kelkheim-Fischbach, Main-Taunus-Kreis] und
dessen Besitzungen in seinen Schutz. Zu den Besitzungen zählen 2 Hufen in Oppershofen (Hapreshoven),
von denen eine jährlich 16 Schillinge abführen muß, die andere 5 Schillinge pro Jahr. |
| 1241 |
Das Stift Retters tritt im Rahmen
eines Tauschgeschäfts alle seine Güter in Oppershofen (Hapershouen) an das
Kloster Arnsburg ab. |
1250/
1260 |
Ein in diesem Zeitraum
entstandenes Verzeichnis der Aktiv- und Passivlehen des Gerhard III. von Eppstein zeigt
diesen als Besitzer bedeutender Rechte in Oppershofen (Aprechteshoven, Apracheshoven,
Hapershoven). All diese Rechte trägt Gerhard vom Pfalzgrafen bei Rhein zu Lehen. |
| 1257 |
Bis spätestens 1257 hat der
Deutsche (Ritter-)Orden seine Besitzungen in Oppershofen an das Kloster Arnsburg
veräußert. Die Besitzungen des Deutschen Ordens gehen auf ehemaligen Eigenbesitz des vor
1211 verstorbenen Wortwin (oder Ortwin) von Homburg zurück. |
| 1274 |
Heinrich von Katzenfurt, Bürger
von Wetzlar, und seine Gattin Kunigunde erwerben von Konrad von Wilnsdorf [bei Siegen],
genannt der Wal, und dessen Gattin Gutta [Jutta] Güter und Rechte in Rockenberg
und Oppershofen. |
1282/
1283 |
Gottfried III. von Eppstein
läßt ein Verzeichnis seiner Aktiv- und Passivlehen anlegen, wie schon sein Verwandter
Gerhard III. Die Schreibweise des Ortsnamens Oppershofen erscheint hier wiederum in
mehreren Varianten: Aprehteshoven, Abrechdeshoven, Apreteshoven, Aprecheshoven,
Hoppershoven. Der oder die Bearbeiter des jüngeren kannten und benutzten das ältere
Verzeichnis von 1250/60. Für beide wurde mutmaßlich ein noch älteres Verzeichnis
benutzt, welches vor oder zu Beginn des 13. Jh. angelegt worden war.
Gottfried besitzt u.a. den Hof in Oppershofen als pfalzgräfliches Lehen. Zu den
Vorgängern der Eppsteiners in diesem Lehen gehörte einst Wortwin von Homburg, der zudem
auch Eigengüter in Oppershofen besessen hatte (vgl. zu 1257!).
Als wichtigste Vasallen der Eppsteiner erscheinen nun Mitglieder der Familie von
Bellersheim, zwischen denen die zur Vogtei Oppershofen gehörenden Rechte aufgeteilt sind. |
| 1287 |
Kloster (Maria-)Thron (bei
Wehrheim, Ts.) besitzt in Oppershofen (Hoppirshobin) Rechte, die in den
nachfogenden Jahrzehnten noch erweitert werden. |
| 1324 |
Der Wetzlarer Bürger Hermann von
Ulm (de Olmena) besitzt umfangreiche Güter in Rockenberg und Oppershofen (Opirßhoben).
Von diesem Sachverhalt erfahren wir durch eine Besitzverschiebung unter seinen
Lehnsgebern. Hermann von Ulm wird mit der Vorgeschichte des um 1338 gegründeten Klosters
Marienschloß in Verbindung gebracht. |
| 1338 |
Auf den 30.April dieses Jahres
ist die Erstausstattungsurkunde für das neu gegründete Kloster Marienschloß datiert.
Die Stifter Johannes von Rockenberg und Ehefrau Gertrud (oft auch: Gezele) von Düdelsheim
haben der neuen Zisterze umfangreiche, vorwiegend gekaufte Güter zugedacht. Zur
Erstausstattung des Nonnenklosters zählen ein Weinberg bei dem Dorf Oppershofen (Hoppirshaben/-in),
gelegen an dem Rodde, mit einem angrenzenden Acker. Ebenfalls gehört dazu die
Mühle, die Creynberg genannt wird und gleichfalls bei Oppershofen liegt. |
1366-
1371 |
Das Kloster Marienschloß legt
ein Verzeichnis seiner Äcker an. Es besitzt v.a. Güter in den Gemarkungen Rockenberg,
Oppershofen und Griedel. |
| 1367 |
Konrad von Oppershofen ist als
dortiger Pfarrer Beichtherr der Nonnen von Marienschloß. |
| 1376 |
Kaiser Karl IV. verpfändet die
beiden Reichsdörfer Rockenberg und Oppershofen für 3000 Gulden an Philipp von
Falkenstein und bestellt ihn zum Amtmann des Reiches über die dortigen freien Gerichte.
Die vordem in Oppershofen dominierenden Eppsteiner hatten ihre Rechte zuvor verloren. |
| 1404 |
Der Altarist Winter Schehle zu
Rockenberg stiftet der Pfarrkirche Oppershofen einen dritten Altar, der St. Jakob geweiht
wurde. Die beiden vorhandenen Altäre waren St. Nikolai und St. Katharina gewidmet. |
| 1467 |
Nachdem die Dörfer Rockenberg
und Oppershofen während der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Dieter von
Isenburg und Adolf von Nassau um den Mainzer Bischofsstuhl [Mainzer Stiftsfehde, 1461-63]
großen Schaden erlitten hatten, ermäßigt Eberhard III. von Eppstein-Königstein die von
'seinen Leuten' zu entrichtenden Zinsleistungen für Atzung, Dienst- und Bannwein von 100
auf 60 Gulden jährlich. |
| 1471 |
Kaiser Friedrich III. verleiht
die Reichsgerechtigkeit, d.h. die damit verbundenen Einkünfte, in den zwei Dörfern
Rockenberg und Oppershofen als Reichslehen an Eberhard III. von Eppstein, Herrn zu
Königstein. Bereits Eberhards Vorfahren wie auch dieser selbst hatten diese Rechte lange
Zeit als Reichspfandschaft für 3000 Gulden inne. Die Eppsteiner hatten die
Reichspfandschaft mit ihrem Anteil am Erbe der 1418 ausgestorbenen Falkensteiner erhalten. |
| 1472 |
Älteste bekannte Markordnung
für Rockenberg und Oppershofen, beschlossen auf einem Märkergericht, niedergeschrieben
durch den Rockenberger Gerichtsschreiber Petrus Orttenberg. |
| 1478 |
Gottfried von Eppstein, Herr zu
Münzenberg, und sein Bruder, der Domherr Johann von Eppstein, verkaufen das Schloß
Ziegenberg samt Zubehör an ihren Vetter, Graf Philipp von Katzenelnbogen, dazu ein
Viertel an Butzbach, ihren Anteil u.a. an den Griedeler Mühlen sowie in dem Gelende,
in Rockenberger Mühlen, die hievor zu Oppershofen gelegen, was an Pföchten,
Mahl-Gästen, Schwein-Mästen, mit dem Rechten unsers Theils des Weingartenbergs zu
Oppershofen, wie dem Zoll und andern daselbst. |
| 1478/79 |
Philipp von Eppstein-Königstein
und Ehefrau Luise von der Mark verkaufen ein Viertel an Butzbach sowie u.a. die Hälfte
der Mühlen zu Griedel, die Rechte an Geleit und Zoll zu Oppershofen und die Hälfte der
Rockenberger Mühle, die vorher zu Oppershofen lag (unser teyle halb In Rockenberger
molen, die hieuor zu Opperßhoff gelegen was) an die Söhne des verstorbenen Grafen
Kuno von Solms, Johann, Philipp und Bernhard. Vom Anteil der Rockenberger Mühle bleibt
eine darauf lastende Verschreibung an die Butzbacher Kugelherren ausgenommen. |
| 1517 |
Das Kugelhausstift (Markusstift)
Butzbach besitzt in Oppershofen (Opperschoben) 2 Hofreiten, die hinter der
Pfarrkirche liegen. |
| 1527 |
Nach einem Zinsbuch des Konrad
von Hattstein [Burg H. b. Schmitten,Ts.] bezog der aus Oppershofen 4 Gulden Zinseinkünfte
und pro Haus 1 Huhn, d.h. jeder seiner 3 Hörigen hatte 1 Huhn jährlich abzuliefern. |
| 1546 |
Der seit 1544 im Amt befindliche
(kath.) Pfarrer von Oppershofen, Johannes Mangk, tritt zur evangelischen Kirche über. |
| 1554 |
Waldordnung für Rockenberg und
Oppershofen. |
| 1565 |
Graf Ludwig von
Stolberg-Königstein verpfändet u.a. eine Jahrrente aus den Dörfern Nieder- u.
Ober-Mörlen, Rockenberg und Oppershofen an Graf Philipp von Nassau-Saarbrücken. |
| 1576 |
Kaiser Maximilian II. nimmt das
Kloster Marienschloß in seinen Schutz und bestätigt ihm all seine Privilegien, u.a. sein
Recht zum Vieh- und Schaftrieb in Rockenberg und Oppershofen. |
| 1577 |
Graf Christoph von
Stolberg-Königstein setzt einen (evangelischen) Hilfs-Prediger und Schulmeister in
Oppershofen ein. Die Schule wurde mit der von Rockenberg vereinigt. |
| 1578 |
Graf Christoph von
Stolberg-Königstein beurkundet, daß er trotz rechtlicher Bedenken einer von seinem
verstorbenen Bruder Ludwig vorgenommenen Verpfändung der Dörfer Nieder- und Ober-Mörlen
sowie Rockenberg und Oppershofen an den ebenfalls schon verstorbenen Engelbrecht Halber
von Hörgern, dessen Ehefrau Dorothea, geb. von Oberkirchen, und deren Erben zugestimmt
habe. |
| 1581 |
Kaiser Rudolf II. gliedert die
Grafschaft Königstein als ehemaliges Reichslehen in den kurmainzischen Staat ein,
unterstellt sie damit der Landeshoheit des Erzbischofs von Mainz. Aus der ehemaligen
Grafschaft wurde nun das Oberamt Königstein. |
| 1590 |
Vergleich zwischen den Grafen von
Stolberg etc. einerseits und dem Erzbischof von Mainz, nunmehr Wolfgang von Dalberg,
andererseits, bezüglich der Graf- und Herrschaft Königstein. Zu dieser zählen auch die
Dörfer Rockenberg (Rogkenberg) und Oppershofen (Oppershoffen) samt allen
hier vorhandenen Rechten.
Die vier Dörfer Rockenberg, Oppershofen (jetzt: Oppershouen), Nieder- und
Ober-Mörlen sambt ihren Ein- und Zugehörungen werden aus der Kellerei Butzbach
ausgesondert. Für diese Dörfer wurde zunächst die kurmainzische Kellerei Kransberg
zuständig, die dem Oberamtmann in Königstein untergeordnet war. |
| 1602 |
Nach 58 Amtsjahren verstirbt
Oppershofens evangelischer Pfarrer Johannes Mangk. Der neue Landesherr, Erzbischof
Johannes Adam von Bicken, war auf gegenreformatorischen Kurs eingeschwenkt und wollte in
seinen Territorien das Motto cuius regio, eius religio [wessen Land, dessen
Religion] durchsetzen. Gegen den Willen der Oppershofener wird am 30. Mai Johannes
Eschwing als neuer katholischer Geistlicher in sein Amt eingeführt, und zwar durch den
gemeinsamen Schultheiß für Rockenberg und Oppershofen. Treibende Kraft im Hintergrund
war die Äbtissin von Marienschloß. |
| 1609 |
Nach dem Tod des Daniel von
Bellersheim erwarb Johann von Hattstein ein Drittel der Erbmasse für 7933 Gulden. Dazu
gehörte das Bellersheimer Haus in Münzenberg. Zu dessen Zubehör gehörten Grundstücke
in Oppershofen, v.a. ein Weinberg am Kraftberg von 3 ½ Morgen Größe. Ein weiterer
Weinberg am Schlitzberg hatte 4 ½ Morgen. [Vermutlich gehörte auch das Bitzengericht zu
den Pertinenzien, obwohl in einem entsprechenden Verzeichnis nur ein Pitzengericht
in Verbindung mit Obbornhofen erwähnt wird, ein Irrtum?] |
| 1613 |
Erzbischof Johann Schweickart von
Mainz vergleicht sich mit Wolf Adam von Schwalbach wegen der Einkünfte des
St.Jakobsaltars in der Pfarrkirche Oppershofen. Bereits 1490 hatte der damalige
Oppershofener Kirchenpatron Gottfried von Eppstein den Oppershofener St.Jakobsaltar sampt
seinen gesellen und einkombsten der Pfarrei Pohl-Göns inkorporiert. Um 1577 bestimmte
Graf Christoph von Stolberg-Königstein, daß die Einkünfte des Oppershofener Altars zum
Unterhalt eines evangelischen Hilfs-Predigers und Schulmeisters für Pohl-Göns verwendet
werden sollen. |
| 1615 |
Johann von Hattstein verkauft das
Bitzengericht an den Mainzer Erzbischof und Kurfürsten Johann Schweickart von Kronberg. |
| 1616 |
Kloster Marienschloß kauft
Äcker in den Gemarkungen Rockenberg und Oppershofen. Vorbesitzer war der verstorbene
Quirin von Bellersheim. Die Äcker sind in einem Verzeichnis aufgeführt, welches nach
1616 im Auftrag des Klosters von dem Rockenberger Gerichtsschreiber Alexander Erb angelegt
wurde. |
[Vgl. die umfangreichere und ausführlichere Zusammenstellung:
Habrahteshouen - Zur älteren Geschichte von Oppershofen (bis 1616): Ein Beitrag zur
Ortschronik / von Dieter Lehmann. - In: 50 Jahre Handball : WSV Oppershofen / Hrsg.: WSV
Oppershofen e.V. Verantwortl. Red.: Manfred Merz. - Rockenberg-Oppershofen 2000, S.
167-184]
____________________
Chronologische
Abfolge der Ortsgeschichte von Oppershofen
vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart
verfaßt von Manfred Breitmoser und Alexander F. Fiolka

Der Dreißigjährige Krieg, der von 1618 -
1648 auf den Schlachtfeldern des alten Kontinents ausgefochten wird, hat große
Umschwünge und Veränderungen herbeigeführt, sei es auf politischem, auf religiösem
oder auf gesellschaftlichem Sektor. Vor allem aber haben die Schreckensjahre, wie es bei
allen kriegerischen Auseinandersetzungen vorprogrammiert ist, immenses Leid über die
unschuldige Bevölkerung gebracht. Auch werden die Bewohner der Wetterau in
Mitleidenschaft gezogen und selbst an Oppershofen und Rockenberg geht der Kriegswahn nicht
spurlos vorüber.
| 1616-17: |
Kurz vor Ausbruch des
Dreißigjährigen Krieges ist für Oppershofen ein Hexenprozeß überliefert. Unter dem
Mainzer Kurfürst und Erzbischof Johann Schweikard von Kronberg (1604-1626) wird die
Ehefrau des Oppershofener „Ackermanns“ Christian Solzbach, zusammen mit zwei
Rockenberger Frauen als Hexe der „Zauberey Laster halb“ angeklagt. Die Frauen
werden in die kurmainzische Kellerei Kransberg überführt, dort wird ihnen der Prozeß
gemacht und etwa drei Monate später werden sie, nach Rockenberg zurückgekehrt,
hingerichtet. |
| 1618: |
Laut eines Berichtes in der
Pfarrchronik von Oppershofen befinden sich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges in
Oppershofen ca. 110 Familien. |
| 1626: |
In der Wetterau wütet die Pest.
Die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern und Städten wird dezimiert, wobei auch
Rockenberg und Oppershofen betroffen sind. |
| 1635: |
Oppershofen wird von
durchziehenden weimarischen Truppen (schwedische Verbündete) überfallen, geplündert und
in Brand gesteckt. Hierbei sind, außer dem Pfarrhaus, die Kirche, die Pfarrscheune und
Pfarrställe abgebrannt und zahlreiche andere Gebäude werden vernichtet. Nach diesem
Überfall ziehen ca. 13 Familien aus Oppershofen nach Rockenberg. |
| 1644: |
An Pfingsten wird ein Teil der
übrigen Häuser durch einen weiteren Brand ein Raub der Flammen, sodaß nur noch zehn
Hofreiten stehenbleiben. |
| 1653/54: |
Durch Bettelgänge und eine
weitgestreute Kollekte können für einen neuen Kirchenbau innerhalb zweier Jahre 640
Gulden gesammelt werden. |
| 1654: |
Von den Oppershofener Bürgern,
die nach dem Krieg langsam ihre Dorfstruktur wieder aufbauen, wird ein neues Flurbuch
erstellt. In dem Kataster sind neben den verbrannten und neu gebauten Häusern, Scheunen
und Stallungen genannt, sowie die Lehenäcker und das eigene „Land unterm
Pflug“. Erwähnenswert ist der hohe Anteil der Weingärten im Vergleich zu dem übrig
bestellten Land. Zusammen mit dem „Hattsteinischen Lehen“ und dem klostereigenen
Weinberg der Zisterzienserinnenabtei Marienschloß zu Rockenberg auf der Südhanglage des
Wingertsberges, ergeben diese eine Gesamtfläche von 53 Morgen Land, die mit Wein bestellt
werden. |
| 1655: |
Unter dem Zisterzienserpater
Caspar Schwenckel von Arnsburg, der die Pfarreien Rockenberg und Oppershofen
administriert, wird für 763 Gulden und 39 Kreuzer die, im Dreißigjährigen Krieg
verbrannte Kirche in Oppershofen in Fachwerkbauweise neu erstellt. Neben den vielen
Spendengeldern stiftet die „gnädige Herrschaft von Kurmainz“ hierzu hundert
Stämme Eichenholz. |
| 1661: |
Die vergangenen, verheerenden
Kriegswirren lassen einen geregelten Ackerbau kaum zu. Durch eine starke
Bevölkerungsdezimierung ergeben sich neue Besitzver-hältnisse und infolgedessen wird auf
kurmainzische nung ein neuer „Schatzungsfuß“ (Bemessungs- grundlage) für
Oppershofen und Rockenberg erstellt. Hierbei werden die Äcker, Wiesen, Holzmarken,
Bäume, Gras-, Kraut- und Weingärten einer neuen Bewertung unterzogen. |
| 1677: |
Der Mainzer Weihbischof Adolph
Gottfried Volusius (1676-1679) weiht unter dem Ortspfarrer Bartolomäus Kopp (1662-1679)
am 24. Juni die neue Pfarrkirche zu Ehren des Hl. Bardo und des Hl. Laurentius. Hierbei
wird der Hochaltar konsekriert, während die beiden Seitenaltäre erst 20 Jahre später
errichtet und geweiht werden. |
| 1681: |
In der Großgemarkung Oppershofen
und Rockenberg führt man einen Grenzgang durch, nachdem durch Kriegseinwirkung
Teilbereiche der Grenze neu vermessen und „ausgesteint“ worden sind. In diesem
Jahr wird unter dem Erzbischof und Kurfürsten Anselm Franz Freiherr von Ingelheim
(1679-1695), die 1635 abgebrannte kurmainzische Zehntscheune wieder aufgebaut. |
| 1684: |
In der Doppelgemeinde nimmt man
die Verwaltungsteilung von Oppershofen und Rockenberg vor. Hierbei erfolgt die Einsetzung
eines Oberschultheißen, der direkt dem Amtsvogt der Kellerei Rockenberg untersteht. Die
zwei auf Lebenszeit gewählten Unterschultheißen werden jeweils von einem jährlich
berufenen Bürgermeister unterstützt. |
| 1688: |
Ein weiterer Schritt zur
Souveränität von Oppershofen erfolgt nun durch die Vermessung der Großgemarkung, welche
mit der 1661 erstellten Bemessungsgrundlage vorgenommen wird. |
| 1689: |
Durch den Einfall französischer
Truppen im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1685-1697) in die Stadt Mainz wird die
kurfürstliche Regierung in ihrer Verwaltung eingeschränkt und die für Oppershofen und
Rockenberg erstellte Vermessung wird gänzlich verworfen. Erst etwa 20 Jahre später wird
sie erneut aufgegriffen. |
| 1697: |
Am 12. Oktober werden die beiden
neu errichteten Seitenaltäre unter dem Pfarrer Jonas Apelinus (1694-1704) konsekriert.
Der linke Seitenaltar wird zu Ehren der Muttergottes, des Hl. Josefs, des Hl. Joachims,
der Hl. Mutter Anna, der Hl. Ursula und aller Hll. Engel geweiht, der rechte Seitenaltar
zu Ehren des Hl. Jakobus d. Älteren, des Hl. Jakobus d. Jüngeren, des Hl. Bonifatius und
des Hl. Bardo („huius fundatoris ac patroni“- hiesigen Gründers und Patrons). |
| 1707: |
Die Gesamtgemarkung Rockenberg -
Oppershofen wird auf Befehl des Mainzer Kurfürsten Lothar Franz Freiherr von Schönborn
(1695-1729) aufgeteilt. Rockenberg erhält somit 7/12 und Oppershofen 5/12 der
Ländereien. Der Wald wird als Markwald gemeinschaftlich genutzt. |
| 1708: |
Ein Jahr nach der
Gemarkungsaufteilung erfolgt am 11. Mai die Grenzvermessung und das Setzen der
Grenzsteine. Fünf Tage später, am 16. Mai, dem Tag „nach dem Sontag Quasimodo
geniti“ findet ein traditioneller Grenzgang statt, bei dem die neue Grenze von
Rockenberger und Oppershofener Bürgern mit ihren Kindern begangen wird. |
| 1709: |
Das nun selbständige,
kurmainzische Dorf Oppershofen umfaßt laut einer durchgeführten Bestandsaufnahme wieder
80 Hofreiten. Es gibt zwei offizielle Zugänge zum Dorf: die Oberpforte, in Höhe des
heutigen Gasthauses zur Wetterau, öffnet den Ort nach Norden hin, also in Richtung
Rockenberg und durch die Unterpforte an der Wetterbrücke kann man das Dorf in Richtung
Westen betreten bzw. verlassen. |
| 1717: |
In Oppershofen, sowie in allen
umliegenden Gemeinden wird ein letztes Mal die Türkensteuer erhoben, die zur Finanzierung
der europäischen Armeen beiträgt. Der Krieg gegen die Türken fordert immense Kosten,
die durch eine Kopfsteuer, auch „Türkenschatzung“ genannt teilweise gedeckt
werden. Der Sieg des österreichischen Feldmarschalls Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736)
über die Türken bei Belgrad im Jahre 1717 bannt diese Gefahr für das Abendland. |
| 1718: |
Bei einem großen Sturm ist die
alte Dorflinde auf dem „Bitzenplatz“ umgestürzt und wird durch einen jungen
Baum ersetzt. Die vermutlich sehr alte Gerichtslinde hat in früherer Zeit für die
verschiedensten Dorfbegebenheiten als „Thing- und Versammlungsstätte“ gedient. |
| 1719: |
Im Dorfbereich werden die
bebauten und unbebauten Plätze mit den neuen „Kurmainzer Ruthen“ vermessen und
von dem versierten Gerichtsschreiber Jakob Weckler aus Rockenberg in ein detailliert
geführtes „Messbuch“ eingetragen. |
| 1723/24: |
Für das alte Rockenberger
Rathaus aus dem Jahre 1531 steht eine Sanierung an. Hierzu sollen die Bürger Oppershofens
ihren finanziellen Beitrag leisten, da die Verwaltung Oppershofens weiterhin in Rockenberg
vorgenommen wird, obwohl die beiden Dörfer bereits seit ca. 40 Jahren eigenständig sind.
Diese Mitfinanzierung Oppershofens für das Rockenberger Rathaus ist Grundlage eines
Streites, bei dem sich die Oppershofener Bürger weigern, die Unterhaltung des maroden
Rathauses finanziell zu unterstützen. Hieraus folgt eine längere, schriftliche
Korrespondenz mit der kurfürstlichen Verwaltung in Königstein. In Oppershofen existieren
seit längerer Zeit Pläne, ein eigenes Rathaus zu errichten. Aus diesem Grund möchten
die Bürger Oppershofens nicht mehr länger an den anteiligen Unterhaltungskosten des
Rockenberger Rathauses beteiligt werden. |
| 1725: |
Am 25. Januar ergeht der Gemeinde
Oppershofen aus Königstein der positive Bescheid zur Erlassung der Unterhaltungskosten
für das Rockenberger Rathaus, verbunden mit der Erlaubnis, ihr eigenes Rathaus und
„Zuchthaus“ errichten zu dürfen. Noch im selben Monat wird im Wald mit dem
Schlagen der Eichenbäume begonnen. Der ortsansässige Maurermeister Heinrich Gondolf
erstellt einen steinernen Unterbau und am 9. August wird das Haus von etlichen Helfern
aufgeschlagen, nachdem es von dem Zimmermeister Victor Sommer und seinen Gesellen
gezimmert worden ist. |
| 1726: |
Nach einjähriger Trocknungszeit
des Fachwerkgefüges wird nach dem Nachschlagen der Holznägel mit dem Lehmbau im
Fachwerkgefüge begonnen, auch werden die Maler- und Tüncherarbeiten in Angriff genommen.
Nach Beendigung dieser Tätigkeiten werden die Türen und Fenster eingesetzt, ebenso die
sandsteinerne Portaltreppe angelegt. |
| 1727: |
Die Malerarbeiten im Inneren des
Rathauses werden begonnen, welche ein Jahr später ihren Abschluß finden An der Südseite
des neuen Rathauses wird ein Leiternhaus angebaut, das die einfache Ausstattung der
kleinen, ortseigenen Feuerwehr beherbergt. Zum Inventar dieses Leiternhauses gehören
neben verschieden großen Leitern auch Feuerhaken und Stangen, während die Feuerspritze
und zahlreiche Ledereimer zur Bekämpfung der auftretenden Brände sich im Innern des
Rathauses befinden. Das Leiternhaus wird im 19. Jahrhundert entfernt. |
| 1729: |
Weitere Ausbauarbeiten im Inneren
des Rathauses werden vorgenommen. Der Rockenberger Schreinermeister Heinrich Mockstadt
wird beauftragt, für den markanten Rathauserker eine Holzskulptur des Hl. Bardo zu
schnitzen. |
| 1730: |
Die Gemeinde erwirbt von einem
Butzbacher „Feuerspritzenmacher“ für 300 Gulden eine moderne Feuerspritze. Sie
ist vermutlich die erste ihrer Art, die für Oppershofen angeschafft wird. |
| 1730/31: |
Mit der Herstellung eines
Rathausschrankes für Gemeindeunterlagen, diversem Mobiliar und der Lieferung eines
geschnitzten Holzkreuzes von besagtem Schreiner- meister Mockstadt, ist nun der gesamte
Ausbau des Rathausinneren abgeschlossen. |
| 1732: |
Am 24. Juli erhält die Kirche
zwei neue Glocken, die von der politischen Gemeinde bezahlt worden sind. Die Glocken
werden von dem Glockengießer Georg Christo Pell in Mainz gegossen und kosten die Gemeinde
473 Gulden. Sie werden zu Ehren der Muttergottes und des Hl. Laurentius geweiht. In diesem
Zusammenhang wird der Dachreiter auf dem Kirchendach erneuert und für die Aufnahme des
neuen Glockenstuhles hergerichtet. |
| 1756-63: |
Im Verlauf des Siebenjährigen
Krieges, den Preußen unter König Friedrich II., dem Großen (1740-1786) mit seinen
Verbündeten auf der einen Seite, und Österreich unter Kaiserin Maria Theresia
(1740-1780) mit wiederum ihren Verbündeten auf der anderen Seite führt, wird auch
Oppershofen und Rockenberg mit einbezogen. Französische Truppen sind als Verbündete der
kaiserlichen Armeen in Friedberg einquartiert und verlangen von den Bewohnern der Wetterau
in hohem Maße Versorgungslieferungen. Auch entgehen die Dörfer nicht den kriegsüblichen
Plünderungen und Brandschatzungen. So notiert der Pfarrer von Oppershofen Georgius
Josefus Schwarz (1759-1800) in einem Kirchenbuch, daß am 6. und 7. Oktober des Jahres
1759 die Franzosen im Dorf “aus Keller und Scheune alles plünderten”. Der
Schaden für Oppershofen beläuft sich auf etwa 6000 Gulden. Ein Kriegsschauplatz ist
sogar ganz in der Nähe. Am 30. August des Jahres 1762 stehen sich bei der Schlacht am
Johannisberg bei (Bad) Nauheim französische und braunschweigische Truppen gegenüber, aus
der die Franzosen siegreich hervorgehen. Der Friede von Hubertusburg beendet den
Siebenjährigen Krieg, der einige Grenzverschiebungen in Europa festschreibt. |
| 1779: |
Auf der vermutlich 1521 unter dem
damaligen Landesherrn Eberhard IV. von Eppstein-Königstein erstellten Steinbrücke wird
eine Sandsteinskulptur des Hl. Johannes von Nepomuk aufgestellt. |
| 1788: |
Nach dem Anwachsen der
Bevölkerung benötigt Oppershofen ein größeres Schulhaus. Mit
“herrschaftlich-kurmainzischer Zustimmung” kann von der Gemeinde ein bereits
bestehendes, zweistöckiges Gebäude in der Hasselgasse erworben werden. Es wird nun den
Erfordernissen gemäß, als Schulhaus und Lehrerwohnung ausgebaut. |
| 1792-97: |
Der Erste Koalitionskrieg bricht
aus. Die neugebildete Französische Republik tritt gegen die Verbündeten Österreich und
Preußen in den Krieg ein. Am 21. Oktober 1792 wird Mainz von den Franzosen eingenommen
und einen Tag später die Stadt Frankfurt. Am 26. Oktober rückt das französische
Revolutionsheer in Friedberg ein und besetzt somit erstmals große Gebiete der Wetterau.
In Rockenberg dringen die feindlichen Soldaten in die Zisterzienserinnenabtei
Marienschloß ein, plündern das Kloster und verschleppen die Priorin und die Cellerarin
über Straßburg bis nach Nancy, während die Äbtissin Philippina Riedel (1774-1792) in
die Abtei Engelthal flüchtet und dort verstirbt. Ende November werden die Franzosen von
hessischen und preußischen Truppen zurückgedrängt. Sowohl die französischen, als auch
die Soldaten der verbündeten Armeen werden teilweise in Oppershofen und Rockenberg
einquartiert, und beide Gemeinden müssen immense Kriegszahlungen leisten. 1796 stoßen
die Franzosen erneut in die Wetterau vor und wieder müssen die Bewohner der umliegenden
Ortschaften für Unterkunft und Versorgung der Soldaten, aber auch der Pferde aufkommen.
In Oppershofen erpressen sie eine Summe von über 1500 Gulden und drohen mit
Brandschatzung und Gewalttaten bei Nichtbefolgung. Für den 8. September 1796 ist eine
Einquartierung von ca. 3000 Franzosen in Oppershofen verzeichnet. Im Oktober 1797 beendet
der Friede von Campoformio die kriegerischen Auseinander- setzungen, jedoch bis zum
Dezember des Jahres 1798 verbleiben französische Soldaten in Oppershofen und Rockenberg. |
| 1803: |
Am 25. Februar 1803 findet in
Regensburg der Reichsdeputations-hauptschluß statt, der die Säkularisierung der
geistlichen Gebiete und die Mediatisierung zahlreicher Reichsstädte beinhaltet. Somit
wird auch in Rockenberg die Zisterzienserinnenabtei Marienschloß aufgehoben und die
Schwestern müssen ihr Kloster nach über 460 Jahren verlassen. In Oppershofen wird die
Nonnenmühle privatisiert und die beiden bisherigen Klostermüller der Doppelmühle sind
nun die neuen Eigentümer. Die Weinberge des Klosters werden aufgegeben und die
Ländereien werden an die ortsansässigen Bauern veräußert. |
| 1806: |
Am 6. August legt Franz II.
(1792-1806) auf Druck Napoleons I. (1804-1814/15) die Kaiserkrone des Heiligen Römischen
Reichs deutscher Nation nieder und beendet somit das alte, seit dem Mittelalter bestehende
Reich. Infolgedessen werden die ehemals kurmainzischen Orte Oppershofen und Rockenberg dem
neuen Großherzogtum Hessen-Darmstadt und bei Rhein zugesprochen. |
| 1817: |
Die beiden Pfortenhäuser, für
die die Gemeinde große Unterhaltungskosten aufbringen muß, werden in einer öffentlichen
Versteigerung an den Meistbietenden verkauft und noch im selben Jahr abgerissen. |
| 1819: |
Der Blitz schlägt in die
Pfarrkirche ein und beschädigt sie stark. Der bereits 1785 geplante Kirchenneubau, der
infolge finanzieller Notlagen immer wieder verschoben worden ist, wird nun dringend
erforderlich. |
| 1826: |
Die alte Pfarrkirche wird
abgerissen und während der Bauzeit wird der Rathaussaal für gottesdienstliche Zwecke
hergerichtet und mit einem kleinen Altar ausgestattet. |
| 1827: |
Die Bauarbeiten an der neuen
Kirche beginnen und am 27. September wird der Grundstein gelegt. Es vergehen zwei Jahre,
ehe die Kirche im klassizistisch-neoromanischen Stil am 16. August 1829 nach einfacher
Einsegnung in Gebrauch genommen wird. Die Baukosten belaufen sich auf 24368 Gulden. |
| 1831: |
Seit jeher sind Brände eine
drohende Gefahr für die Menschheit und gerade in so kleinen und alten Dörfern wie
Oppershofen, in denen die Häuser meistens aus Holz erbaut sind, ist die Bekämpfung des
Feuers immens wichtig. So müssen die Einwohner bereits in früherer Zeit ihren Beitrag
zur Bannung von Bränden leisten, indem sie der Gemeinde Ledereimer stellen müssen, die
bei Feuerausbruch zum Löschen dienen. Seit dem Jahre 1831 gibt es in Oppershofen auf
Veranlassung der „Großherzoglich-Hessisch-Darmstädtischen Regierung“ eine
Pflichtfeuerwehr, in die alle wehrfähigen Männer zwischen 18 und 45 Jahren zum Einsatz
kommen. |
| 1840: |
Der alte Friedhof der
Pfarrgemeinde um die Kirche herum bietet für die Bestattungen nicht mehr genügend Platz
und der neue Friedhof der politischen Gemeinde an der heutigen Södeler Straße wird in
Benutzung genommen. |
| 1842: |
In der Gemarkung Oppershofen in
Richtung Steinfurth wird am sog. „Mühlweg“ eine neue Flurkapelle an der Stelle
eines Vorgängerbaus zu Ehren der Hl. Anna errichtet. |
| 1848-50: |
In der Gemarkung Oppershofen
findet nach 80 Jahren eine Flurvermessung statt und übersichtliche Katasterbücher mit
genauen Maßangaben werden angelegt. |
| 1854: |
Zwei Glocken aus der Pfarrkirche
werden von dem Glockengießer Philipp Heinrich Bach aus Windecken eingeschmolzen und neu
gegossen. |
| 1861: |
Am 10. Juli wird die Pfarrkirche
zu Oppershofen durch den Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler
(1850-1877) zu Ehren des Hl. Laurentius feierlich eingeweiht. Erst in den Jahren 1883-1885
wird die Kirche innen ausgemalt und erhält von den Gebrüdern Rettinger aus Seligenstadt
ihr schönes Deckengemälde in der Apsis mit der Darstellung des Christ Kyrios. |
| 1881: |
In Oppershofen wird ein neues
Pfarrhaus errichtet, nachdem der Vorgängerbau aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen
Krieg verkauft worden ist. Am 21. August findet die feierliche Einweihung durch den
Rockenberger Pfarrer Aloys Mees (1869-1900), im Beisein des Ortspfarrers statt.
Der Männergesangverein „Frohsinn“ Oppershofen wird gegründet. |
| 1882: |
Am 10. Juni wird in Oppershofen,
nach Predigt und Einsegnung des Ortspfarrers Friedrich Appel (1873-1902) ein neues
Schulhaus seiner Bestimmung übergeben. Bereits zwei Jahre zuvor erwirbt die Gemeinde
Oppershofen vom Fürsten zu Solms-Hohensolms-Lich das Areal für den Neubau auf dem sog.
„Mönchshof“ und erbaut 1881 das neue Schulhaus. Der „Mönchshof“ ist
bis zum Jahre 1803 im Besitz der Zisterzienserabtei Arnsburg gewesen, die zur Verwaltung
und Bestellung ihrer zahlreichen Ländereien in Oppershofen diesen Ökonomiehof hier
errichtet haben. |
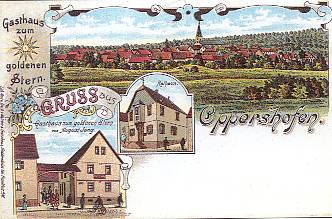 |
| 1908-10: |
Oppershofen erhält mit dem Bau
der Butzbach-Licher-Eisenbahn einen Bahnanschluß. |
| 1912: |
Die St. Laurentius-Kirche erhält
eine neue Orgel, die von dem Orgelbauer Michael Körfer aus Gau-Algesheim errichtet wird.
Teile des Orgelprospektes im klassizistischen Stil werden von der Vorgängerorgel
übernommen. Die neue Orgel besitzt 16 klingende Register, verteilt auf zwei Manuale und
Pedal. |
| 1913: |
Oppershofen wird an die
Überlandzentrale Wölfersheim angeschlossen und erhält somit eine flächendeckende
Stromversorgung der Haushalte.
Im selben Jahr wird der Radfahrverein „Frisch auf“ gegründet. |
| 1914-18: |
Der Erste Weltkrieg bricht aus
und 127 Männer aus Oppershofen werden zum Militärdienst gezogen. Am Ende dieses Krieges
fallen 19 Männer auf dem Schlachtfeld und ein Soldat wird vermißt. |
| 1921: |
Für die St. Laurentius-Kirche
werden drei neue Glocken gegossen, da im Jahre 1917 für Kriegszwecke zwei Glocken
abgegeben und eingeschmolzen worden sind. Am 18. Dezember werden sie feierlich eingeweiht
und auf den Kirchturm verbracht. |
| 1926-28: |
In Oppershofen findet eine
grundlegende Flur- und Feldbereinigung statt, bei der u.a. neue Feldwege angelegt werden. |
| 1931: |
Der Männergesangverein
„Frohsinn“ Oppershofen feiert mit einem Festwochenende und einem Festzug durch
das Dorf sein 50jähriges Jubiläum. |
| 1939: |
Im Kirchenvorstand wird
beschlossen, das alte, baufällige Stallgebäude im Pfarrhof abzureißen und an seiner
Stelle einen Pfarrsaal zu errichten. Am 25.August 1940 findet in Gegenwart aller
Schulkinder die Einsegnung des Raumes statt. |
| 1939-45: |
Der Zweite Weltkrieg bringt
großes Leid über die Bevölkerung. Alle wehrfähigen Männer verrichten den Kriegsdienst
und am Ende des Krieges müssen 61 Männer, alteingesessene Oppershofener, Neubürger und
Heimatvertriebene als Gefallene oder Vermißte verzeichnet werden. |
| 1944: |
In Frankfurt am Main wird das
Kloster der Kongregation der „Armen-Schwestern des Hl. Franziskus“ ausgebombt.
Vier Ordensfrauen kommen am 14. November nach Oppershofen und übernehmen verschiedene
Dienste in der Pfarrei. |
| 1945: |
Am Ende dieses schrecklichen
Krieges verschanzen sich in Oppershofen einige uneinsichtige Soldaten, die das Dorf bis
auf den letzten Mann verteidigen wollen. Die anrückenden, amerikanischen Truppen sind in
der Überzahl und sind fest entschlossen, Oppershofen dem Erdboden gleich zu machen. In
letzter Minute geht diese Gefahr vorüber und am Gründonnerstag rollen die ersten
amerikanischen Panzer durch Oppershofen. Zum Dank für die Rettung des Dorfes wird noch
heute, alljährlich der 8. Dezember als „Gelobter Tag“ feierlich begangen.
Zahlreiche Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten kommen nach Oppershofen und
werden bei einheimischen Familien untergebracht. |
| 1946: |
Am 1. Juni weiht der Bischof von
Mainz Dr. Albert Stohr (1935-1962) das im Pfarrgarten errichtete Schwesternhaus ein. In
dem neuen Kloster „St. Albertus“ ist auch der Kindergarten untergebracht. |
| 1949: |
Erneut werden für die
Pfarrkirche von Oppershofen zwei neue Glocken gegossen, nachdem die zwei größten einige
Jahre zuvor zu Kriegszwecken eingeschmolzen worden sind. Am 22. Mai erfolgt die feierliche
Weihe durch den Mainzer Generalvikar Kastel unter Assistenz der Geistlichen Dr. Friedrich
Winkler (1939-1951) aus Oppershofen, Anton Müller (1939-1951) aus Bad Nauheim und Alois
Degen (1943 1966) aus Butzbach. |
| 1950: |
Der Wander- und Sportverein wird
in Oppershofen, als Nachfolgeorganisation des Wander- und Mandolinenvereins gegründet. |
| 1951: |
Im Juni feiert Oppershofen im
Beisein des Bischofs von Mainz Dr. Albert Stohr ein großes Jubiläum und gedenkt seines
größten Sohnes. Der 900. Todestag des Hl. Bardo wird begangen, der im Jahre 980 in der
Gemeinde geboren worden ist. Der Hl. Bardo ist ins Benediktinerkloster Fulda eingetreten
und später zum Abt der Klöster Hersfeld und Werden ernannt worden. Von 1031 bis 1051
bekleidet er das Amt des Erzbischofs von Mainz, mit dem die Erzkanzlerwürde des Heiligen
Römischen Reichs deutscher Nation verbunden ist. Am 10. Juni des Jahres 1051 verstirbt
Erzbischof Bardo im thüringischen „Dorlar“ bei Mühlhausen und wird nach der
feierlichen Überführung nach Mainz im Ostchor des Domes beigesetzt. |
| 1956: |
Im Juni begeht der
Männergesangverein „Frohsinn“ mit einem großen Fest und einem Umzug durch das
Dorf sein 75jähriges Jubiläum.
Von Juli bis September wird das Innere der Pfarrkirche renoviert und verschiedene bauliche
Veränderungen im Chorraum und im Kirchenschiff werden vorgenommen. Ebenso erhält die
Kirche eine elektrische Heizung und ein elektrisches Geläute. |
| 1958: |
Zwei kirchliche Feste werden in
Oppershofen gefeiert. Am Ostermontag begeht Geistl. Rat Pfarrer Anton Bardo Jung sein
Goldenes Priesterjubiläum und im August zelebriert Gottfried Bell in seiner Heimatpfarrei
sein erstes Hl. Meßopfer. |
| 1960: |
Auf dem alten Friedhof an der
Pfarrkirche wird ein Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege
errichtet, das am 17. Juni feierlich eingeweiht wird.
Die Freiwillige Feuerwehr blickt im Juni auf ihr 25jähriges Bestehen zurück.
Am 10. Dezember wird nach 16 Jahren das Kloster St. Albertus aufgelöst. Wegen
Personalmangels im Mutterhaus in Aachen muß der siebenköpfige Konvent der
„Armen-Schwestern des Hl. Franziskus“ in Oppershofen die Gemeinde verlassen. |
| 1961: |
Nach langen Jahren der Planung
und Vorbereitung wird Oppershofen an das Wasserwerk in Inheiden angeschlossen und erhält
somit fließendes Wasser. |
| 1962: |
Wieder kann in Oppershofen ein
Goldenes Priesterjubiläum eines Sohnes der Gemeinde gefeiert werden. Geistl. Rat Pfarrer
Heinrich Rolly blickt auf den 50. Jahrestag seiner Priesterweihe zurück.
Ein großer Teil der „Rolladenfabrik“ des ortsansässigen Schreinermeisters
Fridolin Weil wird durch einen Brand zerstört. |
| 1963: |
Der Radfahrverein „Frisch
auf“ Oppershofen feiert sein 50jähriges Bestehen. |
| 1966: |
Erneut feiert ein gebürtiger
Oppershofener ein Priesterjubiläum. Geistl. Rat Pfarrer Franz Bayer schaut auf 50 Jahre
priesterlichen Dienst zurück. |
| 1968: |
Das seltene Fest des Diamantenen
Priesterjubiläums kann der in Oppershofen geborene Priester Geistl. Rat Pfarrer Anton
Bardo Jung zusammen mit seiner Heimatpfarrei begehen. |
| 1971: |
Im Rahmen der hessischen
Gebietsreform erfolgt am 26. November in einem feierlichen Akt im Gasthaus „Zur
Wetterau“ die Unterzeichnung des Vertrages der Zusammenlegung der beiden, bisher
eigenständigen Gemeinden Oppershofen und Rockenberg. Die Verwaltungsaufgaben des letzten
Bürgermeisters von Oppershofen Alfred Hofmann gehen auf den Bürgermeister von Rockenberg
Josef Weckler über. Die neue Großgemeinde Rockenberg mit den Ortsteilen Rockenberg und
Oppershofen weist nun ca. 3800 Einwohner auf. |
| 1972: |
Nach Plänen des Architekten
Winfried Bell aus Oppershofen wird ein neuer Friedhof erschlossen und eine Leichenhalle
errichtet. |
| 1973: |
In den Jahren 1973 bis 1976 wird
die Pfarrkirche St. Laurentius zum letzten Mal gründlich renoviert und den Erfordernissen
und Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils angeglichen. Die Kanzel wird entfernt und
ein Zelebrationsaltar aus weißem Stein wird in der Mitte des Chorraumes errichtet. Als
Pendant hierzu wird ein Ambo aus gleichem Material an der rechten Seite des Chores
aufgestellt. |
| 1975: |
Der Wander- und Sportverein
Oppershofen blickt auf 25 Jahre Vereinsarbeit zurück. |
| 1976: |
Am 11. Februar feiert Geistl. Rat
Pfarrer Franz Bayer sein Diamantenes Priesterjubiläum in seiner Heimatpfarrei.
Am 23. Mai findet die Konsekration des neuen Altares in der Pfarrkirche durch den Mainzer
Generalvikar Martin Luley statt. |
| 1980: |
Die Pfarrgemeinde Oppershofen
begeht anläßlich der 1000. Wiederkehr des Geburtstages des Hl. Bardo eine Festwoche, an
der der Bischof von Mainz Hermann Kardinal Volk (1962-1982) teilnimmt. Im Rahmen des
Festprogramms eröffnen Manfred Breitmoser und Gregor Hildebrandt eine reichbestückte
Fotoausstellung im Rathaus. In Anbetracht der großen Resonanz der Ausstellung und des
immer mehr wachsenden Interesses der Bevölkerung an der Ortsgeschichte wird noch im
selben Jahr von den Initiatoren der Ausstellung der Kultur- und Geschichtsverein
Oppershofen ins Leben gerufen. |
| 1981: |
Der Pfarrer von Oppershofen
Eduard Scheld begeht zusammen mit seiner Pfarrei sein Silbernes Priesterjubiläum. Der
Männergesangverein „Frohsinn“ Oppershofen feiert zu seinem 100jährigen
Bestehen ein großes Fest mit einem Wertungssingen. Wegen Überschwemmung des vorgesehenen
Festplatzes wird das Festzelt auf das Areal hinter der St. Anna-Kapelle errichtet. |
| 1983: |
Ein weiteres Silbernes
Priesterjubiläum wird in Oppershofen gefeiert. Pfarrer Gottfried Bell ist vor 25 Jahren
in Mainz zum Priester geweiht worden. |
| 1984: |
Am 23. März erfolgt in
Anwesenheit zahlreicher Gäste die Grundsteinlegung des vom ortsansässigen Architekten
Winfried Bell geplanten Feuerwehrgerätehauses auf dem Gelände hinter dem alten Friedhof.
Nach zweijähriger Bautätigkeit weiht der Mainzer Weihbischof Wolfgang Rolly im August
den neuen Kindergarten der Pfarrei in der St. Annaberg Straße ein. Das moderne Gebäude
ist nach den neuesten Richtlinien und Bedürfnissen der Kindererziehung vom Architekten
Winfried Bell geplant worden. |
| 1985: |
Die Freiwillige Feuerwehr
Oppershofen schaut auf eine 50jährige Tätigkeit in der Gemeinde zurück. Sie löst durch
ihre Gründung im Jahre 1935 die sog. „Pflichtfeuerwehr“ aus dem Jahre 1831 ab.
Zu ihrem Jubiläum kann der FFW das neue Feuerwehrgerätehaus übergeben werden. |
| 1986: |
Auf Anregung des Kultur- und
Geschichtsverein Oppershofen werden am Rathaus in Oppershofen substanzerhaltende
Zimmerarbeiten vorgenommen und mit einem neuen Außenanstrich versehen. Die schadhafte St.
Bardo-Figur und das geschnitzte erzbischöfliche Wappen werden durch Kopien ersetzt. |
| 1987: |
Der Kultur- und Geschichtsverein
Oppershofen e.V. stiftet ein Kreuz aus Kunstsandstein, das im Sommer in Eigenleistung an
der Südseite der Pfarrkirche auf dem alten Friedhof errichtet wird. Gleichfalls wird ein
barockes Taufbecken mit vier Engelsköpfen aus der 1655 erbauten Vorgängerkirche vor dem
Kreuz plaziert. Ergänzt wird das Kreuzensemble durch zwei historische Grabsteine von
Priestern, die in Oppershofen seelsorgerisch gewirkt haben. Es handelt sich um die
Grabdenkmäler von Pfarrer Jakobus Weil von Warnborn (1721-1759) aus dem Jahre 1759 und
von Pfarrer Georgius Josefus Schwarz von Ockstadt (1759-1800) aus dem Jahre 1800. |
| 1988: |
Im Sommer begeht der
Radfahrverein „Frisch auf“ Oppershofen mit einem Festwochenende und einem
Festzug durch das Dorf sein 75jähriges Bestehen.
Im November 1963 wird Eduard Scheld Pfarrer von Oppershofen und blickt somit in diesem
Jahr auf 25 Jahre Seelsorgedienst in der Gemeinde zurück. |
| 1989: |
Die weithin bekannte Gaststätte
„Zur Wetterau“ feiert ihr 175jähriges Bestehen. Im Jahre 1814 eröffnet der
ehemalige Koch und Metzger aus dem Kloster Arnsburg Johann Andreas Hofmann das Gasthaus
und begründet somit den in sechster Generation bestehenden Familienbetrieb, der heute von
Joachim Hofmann geführt wird. |
| 1990: |
Der Kultur- und Geschichtsverein
Oppershofen e.V. begeht sein zehnjähriges Bestehen im Rahmen einer akademischen Feier im
Pfarrhof von Oppershofen und einer Doppelausstellung im Pfarrsaal. In diesen Ausstellungen
wird die zehnjährige Vereinsarbeit dargestellt und dem 900. Todestag des Heiligen
Bernhard von Clairvaux gedacht. In der Klosterkirche zu Rockenberg findet zu diesen
Jubiläen ein Gottesdienst und ein Konzert statt. Weiterhin wird eine Festschrift mit dem
Titel „Oppershofen - Beiträge zur Ortsgeschichte“ herausgegeben.
Geistlicher Rat Pfarrer Paul Graubert feiert an Weihnachten in Oppershofen sein Goldenes
Priesterjubiläum. |
| 1991: |
Im Zuge der geplanten
Dorferneuerung wird erstmals von den Ortsvereinen auf dem historischen
„Bitzenplatz“ ein Weihnachtsmarkt veranstaltet, der von Jahr zu Jahr an Größe
und Attraktivität gewinnt. |
| 1992: |
Am 5. März, dem Tag des
„Großen Gebetes“ in Oppershofen ist Resi Remeter 50 Jahre Organistin.
Am 1. April kommt Oppershofen, als Ortsteil von Rockenberg in das Dorferneuerungsprogramm
des Landes Hessen. Damit wird Oppershofen Förderschwerpunkt für private und kommunale
Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen. |
| 1993: |
Eduard Scheld begeht in diesem
Jahr sein 30jähriges Ortsjubiläum als Pfarrer von Oppershofen. |
| 1994: |
Die Pfarrgemeinde Oppershofen
errichtet nach langen Jahren der Vorbereitung mit den Plänen des Architekten Winfried
Bell ein neues Pfarrzentrum. In Anlehnung an die jahrhundertealte Verehrung des Hl. Bardo
in seiner Heimatgemeinde erhält das neue Gebäude den Namen „Pfarrheim St.
Bardo“. Am Bardotag, dem 10. Juni wird in der Pfarrkirche von dem Mainzer
Dogmatikprofessor Bardo Weiss ein feierliches Amt in Konzelebration gehalten.
Anschließend segnet der Ortspfarrer Eduard Scheld das Pfarrheim ein und übergibt es
seiner neuen Bestimmung. |
| 1996: |
Pfarrer Eduard Scheld feiert
erneut ein Jubiläum in Oppershofen. Vor 40 Jahren wird er im Hohen Dom zu Mainz zum
Priester geweiht. |
| 1996: |
Bereits 1971, als die beiden
Dörfer Oppershofen und Rockenberg zu einer Gemeinde zusammengeschlossen worden sind, ist
der Gedanke des Baus einer Sporthalle in Oppershofen entstanden, aber immer wieder
verschoben worden. Nach mehrjähriger Planung und Bautätigkeit wird eine Mehrzweckhalle
ihrer Bestimmung übergeben. Für die Oppershofener Vereine stehen nun geeignete
Räumlichkeiten für Vereinsarbeit und sportliche Betätigungen zur Verfügung. Die Kosten
für das neue Bürgerhaus in Oppershofen belaufen sich auf ca. 2,5 Millionen DM.
Das Gasthaus „Zum Goldenen Stern“ in Oppershofen besteht nun seit 300 Jahren.
Das heutige Wohn- und Wirtshaus ist im Jahre 1696 von Hans Georg Schmitt, gemeinsam mit
seiner Mutter Margarethe erbaut worden. Im Jahre 1698 wird er erstmals in den
Gemeindeakten als Wirt erwähnt. Seit dieser Zeit befindet sich das Wirtshaus in
Familienbesitz, wenn auch des öfteren in der Geschichte der Name gewechselt ist. So zum
letzten Mal im Jahre 1849, als Johann Heinrich Jung aus Burgholzhausen in den
„Stern“ eingeheiratet hat. In der fünften Generation betreibt nun die Familie
Jung das Wirtshaus „Zum Goldenen Stern“. |
| 1996-98: |
Gegenüber des alten Friedhofs
wird durch die ortsansässige Haus- und Pflegestation Graubert ein modernes Alten- und
Pflegeheim erstellt, das den neuesten Erkenntnissen der Altenpflege und der stationären
Betreuung entspricht. |
| 1997: |
Die zu Beginn des 16.
Jahrhunderts gebaute Wetterbrücke in Oppershofen kann den Anforderungen des
Schwerverkehrs zum Industriegebiet nicht mehr gerecht werden. Aus diesem Grunde wird im
Rahmen des Dorferneuerungsprogramms eine grundlegende Sanierung durchgeführt. |
| 1998: |
Der letzte, aus Oppershofen
stammende Geistliche, Pfarrer Gottfried Bell feiert im August sein 40jähriges
Priesterjubiläum.
Der alte Friedhof an der Södeler Straße, der 1840 in Betrieb genommen worden ist und auf
dem seit 1971 keine Beisetzungen mehr erfolgen, wird im Zuge der Dorferneuerung zu einer
parkähnlichen Anlage umgestaltet. Zahlreiche Gräber werden entfernt, einige historisch
und künstlerisch bedeutende Grabsteine werden an die Friedhofsmauer versetzt, andere
wiederum bleiben an Ort und Stelle, um der neugestalteten Anlage weiterhin den Charakter
eines Friedhofs zu lassen. |
| 1999: |
Als letzte und zugleich größte
kommunale Baumaßnahme des Dorferneuerungsprogramms der Gemeinde Rockenberg wird mit
Fördermitteln des Landes Hessen das historische Rathaus in Oppershofen einer
grundlegenden Sanierung unterzogen. |
| 2000: |
Am 12. März feiert der in
Oppershofen seinen Ruhestand verbringende Geistliche, Pfarrer Dr. Alois Krchnak sein
Goldenes Priesterjubiläum.
Der Wander- und Sportverein Oppershofen e.V. begeht in diesem Jahr das 50jährige
Jubiläum seines Bestehens. Im April findet eine akademische Feier statt und im Juli ein
Festwochenende, verbunden mit einem Festzug durch das Dorf.
Der Kultur- und Geschichtsverein Oppershofen e.V. besteht seit 20 Jahren und erinnert an
seine Gründung im Rahmen einer kleinen Feierstunde und der Präsentation einer
Ausstellung der Vereinsarbeit sowie die Herausgabe einer Festschrift mit dem Titel
„HOSPES AD STELLAM - Zum Goldenen Stern“ - Über 300 Jahre Gaststätte in
Oppershofen - Genealogische Untersuchungen - 20 Jahre Kultur- und Geschichtsverein
Oppershofen e.V.“ |
| 2001: |
Im Juni begeht die Katholische
Pfarrgemeinde St. Laurentius zu Oppershofen gemeinsam mit dem Kultur- und Geschichtsverein
Oppershofen e.V. den 950. Todestag des Ortsheiligen, des Heiligen Bardo. Am 10. Juni wird
mit einem feierlichen Pontifikalamt durch Seine Eminenz, dem Hochwürdigsten Herrn Bischof
von Mainz, Karl Kardinal Lehmann eine Festwoche in Oppershofen eröffnet, die u.a. eine
Ausstellung, verschiedene Gottesdienste und die Herausgabe von drei Publikationen über
den Heiligen beinhaltet.
Das historische Rathaus von Oppershofen aus dem Jahre 1725 wird als letztes bauliches
Objekt im Rahmen der Dorferneuerung von der Gemeinde Rockenberg grundlegend saniert. Im
Obergeschoß wird ein Trauzimmer hergerichtet und das Erdgeschoß für gastronomische
Zwecke ausgebaut; hier eröffnet ein Bürger aus Oppershofen die Gaststätte
„Ratsschänke“ mit einem Freisitz auf der historischen „Bitz“.
Im November wird der bisherige Bürgermeister Patrick Bingel in Direktwahl mit einem sehr
guten Ergebnis in seinem Amt bestätigt. |
| 2002: |
Am 5. März, dem Tag des
„Großen Gebetes“ in Oppershofen kann Resi Remeter auf 60 Jahre Organistendienst
an der Orgel in der Pfarrkirche St. Laurentius zu Oppershofen zurückblicken. |
|
|
| Meister "Adebar" in Oppershofen

Alte Aufnahme um 1910 in der Bardostraße
Personen von links nach rechts:
Margarete Jüngel (Hausbesitzerin)
Elisabeth Jüngel (Tochter von Marg. Jüngel)
Johann Georg Bayer
Heinrich Weil
Wilhelm Rack (im 1. WK gefallen)
alte Frau Weil (Rauscherin)
Johannes Rack
Margarethe Witzenberger (nach Ockstadt verh.)
Maria Witzenberger mit ihrer Schwester Anna
August Heil (Sohn von Lehrer Heil)
Diese Aufnahme entstand in dem Anwesen Jüngel
in der Bardostraße (ein altes Fachwerkhaus aus dem 17. Jh., das in den 60er Jahren des
vorigen Jh. abgerissen wurde). Das Grundstück ist heute im Besitz von Herrn Mielke und
neu bebaut.
|
|