| Home Unser Verein
Oppershofen
Rockenberg
Bardo-Archiv
Marienschloß
- Geschichte
- Chronologie
- Äbtissinnen
- Pröpste
- Klosterkirche
- Gottesdienste
- Glocke
- Wilh.-Leuschner
Ged.-Zimmer
- JVA
Publikationen
Aktuelles
Links
Kontakt |
Chronologie der Zisterzienserinnen-Abtei Kloster
Marienschloß
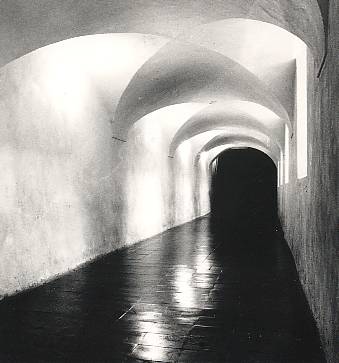
Südflügel des Kreuzgangs unter der Kirche aus dem 14.
Jh.
1337: Heinrich
III. von Virneburg, Erzbischof von Mainz (Amtszeit: 1328-1346) erteilt Ritter Johannes von
Bellersheim genannt von Rockenberg die Erlaubnis bei dem Ort Rockenberg ein Kloster
erbauen zu dürfen.
1338: Am 30. April stiften Ritter Johannes von
Rockenberg, seine Frau Gezele von Düdelsheim, sein Sohn Werner und dessen Ehefrau
Elisabeth von Cronberg das Zisterzienserinnenkloster Marienschloß zu Rockenberg in
Anwesenheit der Äbte Wilhelm von Eberbach und Gerlach von Arnsburg.
1339: Am 19. Februar genehmigt Erzbischof
Heinrich III. von Mainz die Inkorporation der Pfarrkirche zu Rockenberg in das Kloster
Marienschloß.
Am 12. März erlaubt Pfalzgraf Rudolf bei Rhein als Lehnsherr des Gottfried IV. von
Eppstein, des bisherigen Patronatsherrn, die Übertragung des Patronatsrechtes der
Pfarrkirche zu Rockenberg an das Kloster Marienschloß.
Der Bau der Klosterkirche wird vollendet. Am 1. November wird das neue Gotteshaus zu Ehren
der Heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und des Heiligen Johannes des Täufers
konsekriert.
1342: Papst Clemens VI. (Amtszeit: 1342-1352)
weist am 21. August den Generalabt des Zisterzienserordens in Cîteaux an, die Nonnen des
neu gestifteten Klosters Marienschloß in seinen Orden mit allen Freiheiten, Immunitäten
und Rechten desselben aufzunehmen und sie der kirchlichen Aufsicht des Klosters Arnsburg
zu unterstellen.
16 Erzbischöfe und Bischöfe verleihen am 23. August in der päpstlichen Residenz zu
Avignon dem Kloster Marienschloß, allen Kirchenbesuchern und Wohltätern einen
Indulgenzbrief. Es handelt sich um einen Bauablass für die fertig gestellten
Kloster-bauten.
1343: Am 14. Oktober stirbt der Stifter der Abtei
Marienschloß Ritter Johannes von Bellersheim genannt von Rockenberg. Auf dem Grabepitaph
in der Klosterkirche ist er gemeinsam mit seiner Frau Gezele von Düdelsheim dargestellt.
1355: Am 25. Juli vermacht Gezele von Rockenberg
in ihrem Testament dem Kloster Marienschloß zahlreiche Ländereien und Geld.
1356: Äbtissin Gezele von Beheym überträgt am
15. April das Schirm- und Vogteirecht über das Kloster Marienschloß dem Grafen Gottfried
von Stockheim, dem Schwiegersohn des Stifters Werner von Rockenberg.
1360: Kaiser Karl IV. (1347-1378) stattet das
Kloster Marienschloß mit etlichen Privilegien aus und bestätigt Gottfried von Stockheim
das Schirm- und Vogteirecht.
1466: Infolge der schlechten Aufsichtspflicht des
Abt-Visitators Johannes von Arnsburg stellen sich auch im Kloster Marienschloß
Missstände und Regelübertretungen ein. Adolf II. von Nassau, Erzbischof von Mainz
(1461-1475) fordert durch seinen Generalvikar Siegfried sämtliche Schwestern mit ihrer
Äbtissin Lucia von Weisen auf, die Abtei zu verlassen, besetzt das Kloster mit einem
neuen Konvent von strengerer Observanz und ernennt Adelheidis von Schwalbach zur neuen
Äbtissin.
1483: Am 10. Juni erhält der Erzbischof von
Mainz, Adolf III. von Sachsen (1482-1484) von dem an der Kurie tätigen Bischof Julianus
von Ostia ein Schreiben, in dem dieser Elisabeth Schwalbach päpstliche Dispens erteilt
und den Fall dem Erzbischof übergibt. Als Nichtadelige fand sie bisher keine Aufnahme in
einem regulierten Orden. Durch diesen Dispens stellt ihr Bischof Julianus frei, in welches
Kloster sie eintreten möchte. Elisabeth Schwalbach wird Profeßschwester im Kloster
Marienschloß.
1508: Unter Äbtissin Guda Brand von Buseck erfolgt am
25. Oktober durch die Äbte Heinrich von Bursfelde und Thomas von Seligenstadt die
Aufnahme des Klosters Marienschloß, seiner Ordensfrauen, Pröpste und Laien in die
Konfraternität der Bursfelder Kongregation.
1534: Auf Veranlassung der Äbtissin Lucia von
Trohe als Patronatsherrin muss der bereits 16 Jahre amtierende Pfarrer von Rockenberg
Caspar-Göbel, der seit 1533 verheiratet ist, die Messe nach dem römischen Ritus ablehnt
und nach der lutherischen Lehre predigt, die Pfarrei Rockenberg verlassen.
1563: Rockenberg und Oppershofen, die seither im
Besitz des Hauses Königstein waren, gelangen nach dem Aussterben dieses Geschlechtes
durch Erbteilung an das Haus Stolberg. Graf Ludwig von Stolberg führt den Protestantismus
in seinem Territorium ein und während die Bevölkerung der beiden Gemeinden evangelisch
wird, bleibt der Konvent von Marienschloß seinem katholischen Glauben treu. Als Patronin
der Pfarrkirche von Rockenberg hat die Äbtissin in der Folgezeit den protestantischen
Geistlichen zu präsentieren, ist jedoch immer darauf bedacht, das Amt des evangelischen
Pfarrers an solche Bewerber zu vergeben, die sich gegenüber dem katholischen Kloster
tolerant erweisen.
1576: Kaiser Maximilian II. (Amtszeit: 1564-1576)
bestätigt die dem Kloster Marienschloß verliehenen Privilegien, Immunitäten und Rechte
und nimmt es in seinen und des Reiches besonderen Schutz.
1581: Die ehemalige Grafschaft Königstein fällt
nach dem Aussterben des Hauses Stolberg als erledigtes Reichslehen an das Kurfürstentum
Mainz und seit diesem Zeitpunkt ist der Erzbischof von Mainz nicht nur geistliches,
sondern auch politisches Oberhaupt der Gemeinden Rockenberg und Oppershofen.
1598-1619: Noch vor Beginn des Dreißigjährigen
Krieges werden in der Wetterauabtei zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Aufgrund des
sumpfigen Gebietes, auf dem das Kloster erbaut worden ist, entschließt man sich das
Bodenniveau der Klosterkirche zu erhöhen. Ab 1598 wird dieses Bauvorhaben begonnen. Im
Jahre 1606 wird das Nonnenchor renoviert und 1607 lässt man die sog. Gesindekirche, also
das eigentliche Kirchenschiff weißen. 1608 erhält das Gotteshaus einen neuen Altar, der
in Frankfurt hergestellt und dort abgeholt wird; die zugehörige Altartumba wird zuvor von
ortsansässigen Handwerkern gemauert.
1610 wird mit dem Bau eines neuen Konventgebäudes und einer neuen Pforte begonnen.
1611/12 erfolgt die Innenausstattung des Konventgebäudes aus Holz und in den einzelnen
Zellen der Schwestern werden neue Öfen aufgestellt. 1619 wird ein neuer Kreuzgang
errichtet, welcher bereits 1609 nur hinreichend repariert worden war.
Am Anfang seiner Regierungszeit lässt der Abt von Arnsburg, Wendelinus Fabri (Amtszeit:
1615-1631) zur Ehre Gottes, der Heiligen Anna, der Jungfrau Maria und zum Gedächtnis
seiner Mutter einen neuen Altar in der Abteikirche errichten.
1602/03: In Oppershofen und Rockenberg findet unter
Erzbischof Johann Adam von Bicken (Amtszeit: 1601-1604) die Gegenreformation erfolgreich
statt. Während Oppershofen bereits im Jahre 1602 rekatholisiert wird, erfolgt in
Rockenberg erst 1603, auch durch vehementes Drängen der Äbtissin Margarethe Rau von
Holzhausen die Wiedereinführung des katholischen Glaubens.
1618-48: Der Dreißigjährige Krieg nimmt auch in
Rockenberg und Oppershofen verheerende Auswirkungen an. Aus mehreren Berichten u.a. von
1623, 1635, 1643 und 1645 der Äbtissinnen Margarethe Kräch und Anna Mailach geht hervor,
dass das Kloster Marienschloß sowohl von den Soldaten der katholischen Liga, als auch der
protestantischen Union mehrmals geplündert, gebrandschatzt und ausgeraubt wird. Nachdem
die Schwestern von kaiserlichen Soldaten aus dein Kloster vertrieben worden sind, nimmt
sich der Arnsburger Pater Caspar Schwenckel ihrer an, bringt ihnen die heilige Kommunion
und ermutigt sie zum Ausharren.
1729: Nach den Wirren des Dreißigjährigen
Krieges und nur notdürftiger Reparationsmaßnahmen beginnt nun in der Zeit des Barock
eine rege Bautätigkeit im Kloster Marienschloß und als Patronatsherrin der Pfarrei
Rockenberg lässt Äbtissin Franziska Koch (Amtszeit: 1724-1736) ein neues Pfarrhaus in
Rockenberg erstellen.
1733/35: Äbtissin Franziskas Wappen über dem Portal
schmückt das neue Äbtissinnengebäude, welches sie 1733 errichten ließ. Die neue,
äußere Klosterpforte von 1735 ziert ebenfalls ihre Initialen mit der Jahreszahl 1735 und
kennzeichnet sie als Bauherrin.
1737: Am Kreuzgang erfolgen Umbaumaßnahmen und der
Westflügel wird um eine Etage aufgestockt. Hier befindet sich über der Eingangstür im
Westen das Wappen der Äbtissin Antonia Hartz (Amtszeit: 1736-1774) und die Jahreszahl
1737.
1741: Das Propsteigebäude, heute eher bekannt als
Langer Beamtenbau, wird im äußeren Klausurbereich, ebenfalls unter der Äbtissin Antonia
Hartz errichtet. Der Grundstein ist noch heute vorhanden.
1746: Unter Äbtissin Antonia Hartz wird am 5.
Mai, im Beisein des Abtes von Arnsburg Petrus Schmitt (Amtszeit: 1746-1772) aus
Rockenberg, der Grundstein für die neue Klosterkirche gelegt.
1754: Auch wird unter Äbtissin Antonia in ihrer
Funktion als Patronatsherrin der Pfarrei Rockenberg eine neue Pfarrkirche erbaut, bei der
das Kloster die Baukosten für die Erstellung des Chores übernimmt.
1777: Der Abtei Marienschloß fällt aufgrund
eines Vertrages vom 11. Dezember mit dem Rockenberger Ortspfarrer Johann Baptist Ludwig
das gesamte Pfarrgut von Rockenberg zu, welches dann im Jahre 1803 zusammen mit dem
Klosterbesitz säkularisiert wird.
1778: Der Hochaltar in der Klosterkirche wird
unter Äbtissin Philippina Riedel (Amtszeit: 1774-1792) fertig gestellt und konsekriert.
Das Chronogramm am Hochaltar beschreibt Äbtissin Antonia und sie als Erbauerinnen des
Altares.
1792: Äbtissin Philippina Riedel flüchtet ins
Kloster Engelthal, nachdem die französischen Revolutionstruppen das Kloster Marienschloß
besetzt haben. Sie stirbt dort einige Zeit darauf.
1802/03: Am 25. Februar 1803 findet der
Reichsdeputationshauptschluß zu Regensburg statt, in dem die Säkularisation der
geistlichen Staaten, Stifte und Klöster und die Entschädigung der deutschen Fürsten mit
diesen Territorien für ihre verlorenen links-rheinischen Gebiete niedergeschrieben und
festgesetzt wird.
Bereits am 22. November 1802 nimmt der Landgraf von Hessen-Darmstadt, Ludwig X. (Amtszeit:
1790-1830) die kurmainzischen Ämter Vilbel und Rockenberg und die
Zisterzienserinnen-Abtei Marienschloß in Besitz.
Alexander Weitzel (Amtszeit: 1799-1803), der 53. und letzte Abt des Zisterzienserklosters
Arnsburg und gebürtiger Rockenberger wohnt, nachdem er aus seiner Abtei vertrieben worden
ist, mit einigen seiner Mönche vom Juli 1803 bis zum Jahre 1806 im Kloster Marienschloß
und zieht dann in das eigens für ihn erbaute Wohnhaus in der Obergasse (heutiges
Rathaus), in dem er im Jahre 1819 stirbt.
1808/27: Die 30. und letzte Äbtissin des
Zisterzienserinnenklosters Marienschloß Edmunda Dietz (Amtszeit: 1797-1803) und die
sieben noch dort verbliebenen Ordensfrauen verlassen im Jahre 1808 ihre Abtei und ziehen
in ein Wohnhaus in Rockenberg. Äbtissin Edmunda stirbt am 2. September des Jahres 1827
und wird gemeinsam mit ihrer bereits 1818 verstorbenen, leiblichen Schwester Benedicta,
Nonne in der Abtei Engelthal, auf dem Friedhof in Rockenberg beigesetzt.
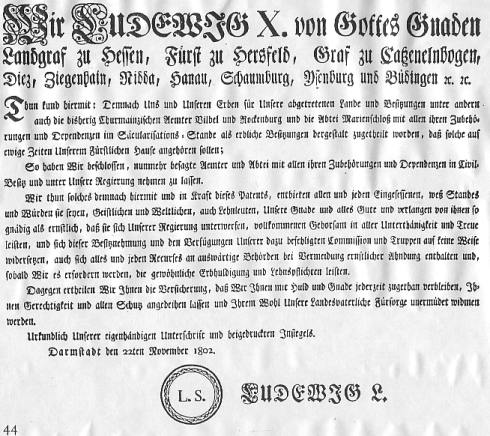
Urkunde des Landgrafen Ludwig X. von Hessen-Darmstadt
zur Säkularisation der
Abtei Marienschloß vom 22. November 1802
Fortsetzung siehe unter JVA
Rockenberg
|