| Home Unser Verein
Oppershofen
Rockenberg
Bardo-Archiv
Marienschloß
- Geschichte
- Chronologie
- Äbtissinnen
- Pröpste
- Klosterkirche
- Gottesdienste
- Glocke
- Wilh.-Leuschner
Ged.-Zimmer
- JVA
Publikationen
Aktuelles
Links
Kontakt |
Geschichte
Inhalt:
- Die Zisterzienserinnen
- Der Tagesablauf in einem
mittelalterlichen Zisterzienserinnenkloster
- Klosterämter
Die
Zisterzienserinnen
Der weibliche Zweig des Zisterzienserordens ist nicht, wie
der männliche, aus einer Gegenbewegung zum Benediktinerorden cluniazensischer Prägung
entstanden, sondern ging aus der religiösen Frauenbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts
hervor.
Mit der allgemeinen religiösen Bewegung ihrer Zeit hatte die Frauenbewegung eine
christliche Lebensgestaltung zum Ziel, die in der Gemeinschaft in Armut und Keuschheit
erstrebt wurde.
So verschieden die Herkunft der einzelnen und das gesellschaftliche Bewusstsein der
damaligen Zeit auch waren, einig waren sich alle in dem göttlichen Heilsplan, der in die
ewige Seligkeit mündet.
Viele dieser Frauen wurden von der Lebensgestaltung des neu entstandenen
Zisterzienserordens angezogen. Sie bildeten Klostergemeinschaften, die nach der Regel des
Heiligen Benedikt und den Gewohnheiten der Zisterzienser lebten. Sie erstrebten die
Eingliederung (Incorporation) in den Zisterzienserorden. Dank ihrer guten Beziehungen zu
Stephen Harding, dem 3. Abt von Cîteaux, erreichten 1125 erstmals die Nonnen des
französischen Klosters Tart die Aufnahme in den Orden, und zwar in der juristischen Form
der Incorporation. Sie besagte, dass die Nonnen vollständig zum Orden gehörten, und sie
wurden durch diese fortan geistlich betreut und hinsichtlich der Wirtschaftsführung und
der Beobachtung der klösterlichen Disziplin durch regelmäßige Visitationen
unterstützt. Beauftragt wurde damit der Abt eines nahegelegenen Zisterzienserklosters; im
Fall von Kloster Marienschloß war dies die Abtei Arnsburg. Er hatte auch die geistliche
Jurisdiktion des Ordens auch bei Äbtissinnenwahlen und bei Entgegennahme der Profess
– der Klostergelübde – wahrnehmen.
Die Zahl der Frauenklöster wuchs dann viel schneller, als die der Männerklöster.
Dem Zisterzienserkloster Arnsburg waren schließlich sieben Frauenklöster unterstellt:
Marienthal (Netze), Kaldern (bei Marburg), Maria Thron (Wehrheim/Taunus), Engelthal (bei
Altenstadt), Patershausen (Heusenstamm), Marienborn (bei Büdingen) und Marienschloß (bei
Rockenberg).
Der Tagesablauf in einem mittelalterlichen
Zisterzienserinnenkloster
Das Kloster war ein, von der Außenwelt abgeschlossener
Bezirk, in dem außer dem Wohngebäude auf jeden Fall eine Kirche vorhanden sein masste,
in der siebenmal am Tag und einmal in der Nacht das Lob Gottes in lateinischer Sprache
gesungen und gebetet wurde.
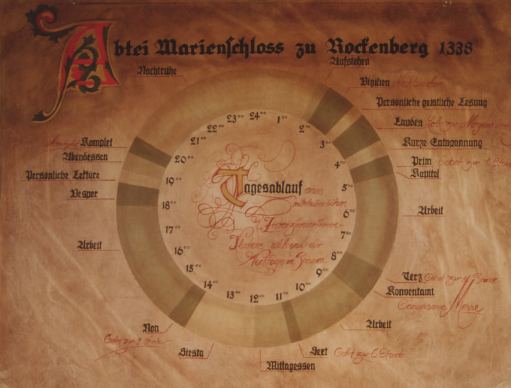
Tagesablauf eines mittelalterlichen
Zisterzienserinnenklosters während der Werktage
im Sommer (Abtei Marienschloss)
Das erste Zeichen hierzu erfolgte einige Stunden vor
Tagesanbruch – in unserer heutigen Zeitrechnung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts
– im Dormitorium, dem gemeinsamen Schlafsaal, und man begab sich bald danach in den
Chorraum der Kirche zu den Vigilien, den Nachtwachen des Gebets.
Da es damals noch kein elektrisches Licht gab und der Chor nach Ordensbrauch nur mit fünf
Öllampen erleuchtet war, mussten alle Psalmen Antiphonen und Hymnen auswendig gebetet
bzw. gesungen werden. Zum Vortrag der Lektionen aus der Hl. Schrift und den Erklärungen
der Kirchenväter hielt die, je für eine Woche bestimmte Lektorin eine Absconse –
ein kleines Öllämpchen – in der Hand.
Nach den Vigilien wurden im Kapitelsaal Lichter für die persönliche geistliche Lesung
aufgesteckt. Die Bücher erhielt man durch die Kantorin aus dem Armarium – der
Bücherkammer – zugeteilt, und es war ein Anliegen des Generalkapitels, dass
genügend gute und vom Orden geprüfte Bücher vorhanden waren. Zur Sommerzeit saß man
auch im Claustrum, wie der Garten des Kreuzgangs auch genannt wurde. Die älteren Nonnen
vertieften sich in die Schrifterklärungen der Kirchenväter oder in die Heiligenviten,
während die jüngeren ihre Lesezeit vorwiegend auf das Auswendiglernen der liturgischen
Texte verwenden mussten. Eine Nonne beobachtete jeweils den Himmel, da sie bei
Sonnenaufgang das Zeichen zu den Laudes, dem ersten Gotteslob des Tages, zu geben hatte.
Der liturgische Aufbau dieser längsten und feierlichsten Gebetshore des Vormittags
entspricht dem der Vesper, anstelle des Magnificats finden wir dort das Benedictus, den
Lobgesang des Priesters Zacharias, des Vaters Johannes’ des Täufers.
Auf die Laudes folgte nach einer kurzen Entspannung die Prim, die stets mit dem Hymnus
begann und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Liturgiereform zum Opfer gefallen
ist. Danach zog man in Prozession vom Chor erneut in den Kapitelsaal, wo durch die
Äbtissin ein Kapitel der Ordensregel verlesen und erklärt wurde und den Nonnen die
Tagesarbeit zugewiesen wurde. Im Sommer begab man sich hiernach sofort an die Arbeit,
während man im Winter bis zur nächsten Hore lesen konnte.
Das Gebet zur dritten Tagesstunde heißt Terz und gilt in erster Linie dem Heiligen Geist,
der zur dritten Stunde an Pfingsten auf die Jünger herabkam. Sie ging stets unmittelbar
dem Konventamt, der Eucharistiefeier der Klostergemeinde voraus, das schon seit jeher den
Mittelpunkt des klösterlichen Tages bildete.
Im Winter zog man sich hiernach zur Lesung zurück, im Sommer war es jetzt überall im
Hause hinreichend hell für die Arbeit. Sie wurde im Zisterzienserorden stets
hochgeschätzt, gemäß der Weisung des 48. Kapitels der regula Benedicti: „Der
Müßiggang ist ein Feind der Seele, und deshalb sollen sich die Brüder zu bestimmten
Stunden mit göttlicher Lesung beschäftigen.“ Die Tagesordnung wurde daher auch in
den Frauenklöstern durch den Wechsel zwischen Gebet, geistlicher Lesung und Arbeit
bestimmt.
Der Vormittag endete mit der kleinen Hore der Sext, in der man vor allem um die Gnade der
Beharrlichkeit in den Anfechtungen der Mittagszeit und in der Lebensmitte flehte. Dann
folgte das gemeinsame Mahl im Refektorium – dem Speisesaal – und hiernach war
bis zur kleinen Hore der Non eine Ruhepause, die sog. Rekreation vorgesehen. In dieser
Gebetszeit zur neunten Stunde gedachte man des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Man nahm
danach wieder die Arbeit auf, bis das Zeichen zur Vesper gegeben wurde, die man, wie die
Laudes, täglich feierlich sang. Den Höhepunkt beider Gottesdienste bildete das, von der
Äbtissin gesungene Vater unser, gemäß der Weisung des 13. Regelkapitels: „Die
Morgen- und Abendfeier sollen aber nie beendet werden, ohne dass am Schluss das Gebet des
Herrn vom Oberen, allen vernehmbar ganz gesprochen wird, wegen der Dornen und Ärgernisse,
die leicht entstehen, damit sich die Brüder, durch das Versprechen in diesem Gebet
„Vergib uns, wie auch wir vergeben“ verpflichtet, von solcher Schuld
reinigen.“
War die Vesper verklungen, gab man sich nochmals der persönlichen Lektüre und nach einem
kargen Abendessen einer gemeinsamen Lektüre hin, bis es nach Einbruch der Dunkelheit Zeit
zur Komplet war, der letzte Hore am Tage, in der für eine ruhige Nacht und ein seliges
Ende gebetet wurde. Geendet hat die Komplet mit dem Gruß an die Gottesmutter durch das
Salve Regina und dem Segen der Äbtissin mit Weihwasser. Nun beginnt das große Silentium,
das nach einer wohlverdienten Nacht nach den Vigilien wieder endet. So ist ein Tag im
Leben einer Zisterzienserin und ihr ganzes Dasein geprägt durch das Gebet und die Arbeit,
durch „ora et labora“.
Klosterämter
Ämter im Konvent
Äbtissin
Priorin
Subpriorin
Bursiererin
Cellerarin
Kantorin
Sakristanin
Magistra (Novizenmeisterin)
Infirmarin (Krankenschwester)
Pförtnerin
Küchenmeisterin
Weinmeisterin
Brotmeisterin
Kornmeisterin
Ämter im Wirtschaftsbereich
Keller
Hofrichter
Schaffner
Bäcker
Müller
Schäfer
Für die Nonnen des Mittelalters bestand die Handarbeit zum Teil in den Diensten des
gemeinsamen Hauswesens. Ohne die maschinellen Hilfen von heute erforderten sie damals viel
mehr Zeit. Eine Hauptbeschäftigung muss das Wollspinnen gewesen sein, denn der Orden
schrieb statt des teuren Linnen oder schwarzgefärbten Tuches schafwollene, ungefärbte
Kleidung vor.
Die Abtei Marienschloß beschäftigte einen Schäfer, der die große Schafherde des
Klosters betreute, wie aus einem Rechtsstreit um den Schaftrieb mit den Gemeinden
Rockenberg, Oppershofen und Griedel hervorgeht.
Eine künstlerische Betätigung der Nonnen von Marienschloß ist uns durch eine
Applikationsarbeit auf Stoff und Papier mit einem kleinen Medaillon überliefert.
Vermutlich existierte auch in Marienschloß, ebenso wie sie für die
Zisterzienserinnenabtei Engelthal bezeugt ist, eine Paramentenstickerei. Besonders in der
Barockzeit bestand ein großer Bedarf an liturgischer Kleidung in den Klöstern, die
aufwendig und prunkvoll gestaltet wurden. So ist anzunehmen, dass die Nonnen von
Marienschloß nicht nur ihren Eigenbedarf an Paramenten fertigten, sondern auch für das
Männerkloster Arnsburg liturgische Kleidung in all ihrer Vielfalt lieferten.
Arbeiten, die man nicht ohne Schwierigkeiten zu jeder Gebetszeit unterbrechen konnte,
wurden durch sog. Laienschwestern (Konversinnen) verrichtet. Sie waren nicht zur Teilnahme
am Chorgebet verpflichtet und konnten sich so ganz ihrer Arbeit widmen. In dem heute
bestehenden Zisterzienserorden mit den unterschiedlichen Observanzen gibt es diese
Unterscheidung von Chor- und Laienschwestern nicht mehr.
|